Vitamin D statt Grippe-Impfung
Vitamin D kannte man früher vor allem als Mittel gegen Rachitis. Neueste Studien werfen aber ein völlig anderes Bild auf das Vitamin: Vorbeugung gegen Krebs, Herzkreislauferkrankungen und einer Reihe von anderen Krankheiten, wie Psoriasis, Muskelschwäche, Rachitis, PMS, Rücken- und Knochenschmerzen, Knochenschwund, Bluthochdruck, Typ-I-Diabetes, Alzheimer, rheumatoider Arthritis, Depressionen, neurologische Erkrankungen, sowie Störungen des Immunsystems.
Vitamin D - das Sonnenvitamin
Vitamin D ist ein fettlösliches „Vitamin“, welches aus Cholesterin endogen synthetisiert wird. Es zeigt aufgrund seines Ursprungs, seiner Synthese sowie seiner Funktionen Verwandtschaft mit Steroidhormonen. Ein Teil des Bedarfs wird mittels photochemischer Synthese von Vitamin D in der Haut gedeckt. Wanderbewegungen des Menschen von Zentralafrika in den Norden führten zur Aufhellung der Haut und somit zu einer „effektiveren“ Nutzung der UV-Strahlen. Dennoch reicht die Sonnenintensität im Winter in Europa für eine Bedarfsdeckung nicht aus! Die Bildung ist zudem stark abhängig von der draußen verbrachten Zeit, der Tageszeit, der Höhe und des Breitengrads, der Jahreszeit, der Luftverschmutzung, der Art der Kleidung, der Pigmentierung der Haut, des Alters, der Bewölkung und des aufgetragenen Sonnenschutzes (bei dauerhafter Verwendung von LSF 15 ist die Vitamin-D-Produktion um 99,5% reduziert).
Während der Sommermonate würde ein Mensch mit heller Haut bei direkter Sonnenstrahlung (in Badekleidung, ohne Sonnenschutz) zur Mittagszeit etwa 10.000 - 20.000 IE in 10 bis 20 Minuten (je nach Hauttyp) produzieren. Personen mit dunkler Haut produzieren je nach Pigmentierung entsprechend weniger. Dreimal pro Woche reicht aus, um optimal mit Vitamin D versorgt zu sein.
Im Winter ist jedoch die Vitamin D Bildung unzureichend, da die Sonneneinstrahlung zu schwach ist und nicht genügend UVB Strahlen durchlässt.
Unzureichende Aufnahme über die Nahrung
Vitamin D findet man vor allem in fettem Fisch, Lebertran, Innereien sowie in geringen Mengen in Milch, Eiern, Butter. Ein Kompensation über diese Nahrungsmittel ist in vilen Fällen nicht möglich, da meist die Vitamin D Speicher zu Beginn des Winters nicht komplett aufgefüllt sind und die Menge von Vitamin D in diesen Lebensmitteln für einen ausreichenden Spiegel alleine nicht ausreicht.
In Lebensmitteln finden Sie etwa folgende Inhaltsmengen:
250 - 300 mcg/100ml in Lebertran
20-25 mcg/100g in Räucheraal, Hering
16 mcg/100g in Lachs
11 mcg/100g in Sardinen
3,8 mcg in Kalbfleisch
3,4 μg / 100 g in Avocado
2 μg / 100 g in Pilzen
1,7 mcg/100g in Leber (Rind)
1 mcg/100g in Hühnerei
1 mcg/100g in Butter
1,1 mcg/100g in Emmentaler
0,19 mcg/100g in Speisequark (40%Fett)
0,06 - 0,08 mcg/100g in Vollmilch, Joghurt (3,5%)
Wirkungen von Vitamin D
- Vitamin D stärkt die Knochen
Zusammen mit Kalzium und Vitamin K2 spielt Vitamin D eine Schlüsselrolle im Stoffwechsel unserer Knochen, insbesondere beim Aufbau neuer Knochenmasse. Wird deshalb auch als Rachitis Prophylaxe eingesetzt. - Vitamin D schützt vor Krebs
Verschiedene Studien zeigen, dass ein hoher Vitamin D Spiegel im Blut das Risiko an Krebsarten wie zum Beispiel Darm- oder Brustkrebs um circa 40 bis 50 Prozent verringert. Vitamin D wirkt vermutlich der Entartung von Zellen und damit der Entstehung von Tumoren entgegen. Selbst geringe Mengen Vitamin D (400 IE) können das Brustkrebsrisiko bereits um 24 Prozent senken. - Vitamin D schützt vor Erkältungen und Influenza
Ein niedriger Vitamin D Spiegel erhöht das Risiko für Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege um etwa 40%. Dies ergab die Auswertung der Daten von 19 000 Menschen, welche im Durchschnitt einen 25(OH) Vitamin D3 Wert von 10 bis 29 ng/ml aufwiesen. Der Abfall des Vitamin D Spiegels im Winter durch das fehlende Sonnenlicht ist auch einer der Gründe, warum Influenza-Wellen immer im Winter auftreten. - Vitamin D schützt vor Diabetes
Vitamin D schützt die insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse. Außerdem steigert es die Insulinempfindlichkeit. Mit Hilfe von Vitamin D kann also der Zucker viel schneller aus dem Blut in die Zellen transportiert werden. Ingesamt mindert es so das Risiko, an Diabetes zu erkranken.(Int J Endocrinol. 2013;2013:148673. doi: 10.1155/2013/148673. Epub 2013 Mar 13. The role of vitamin d deficiency in the incidence, progression, and complications of type 1 diabetes mellitus.) - Vitamin D aktiviert das Gehirn
Menschen mit einem hohen Spiegel an Vitamin D können sich besser konzentrieren, sind aufmerksamer und zeigen eine bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit als Mangelpatienten. Zu diesem Schluss kommen Forscher der britischen Universität Manchester, die in einer europaweiten Studie 3000 Männer im Alter zwischen 40 und 79 Jahren untersucht hatten. (J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jul;80(7):722-9. doi: 10.1136/jnnp.2008.165720. Epub 2009 May 21. Association between 25-hydroxyvitamin D levels and cognitive performance in middle-aged and older European men.)
In der EsKiMo-Studie des Robert-Koch-Institutes und der Uni-Paderborn wurde die Nährstoffzufuhr von Kindern untersucht. In der Gruppe der 6-11-jährigen lagen 100% der Probanden unterhalb der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr. Studien an Erwachsenen ergeben ebenfalls eine Unterversorgung mit Vitamin D – insbesondere in den Wintermonaten. Vitamin D spielt nicht nur im Calcium- und Knochenstoffwechsel eine maßgebliche Rolle. Die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft belegen, dass eine Unterversorgung mit Vitamin D zu Störungen im Immunsystem, zu einem erhöhten Krebsrisiko sowie zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen kann.
Die empfohlene Menge ist viel zu gering !
Die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) empfiehlt eine Zufuhr von 400 IE für Säuglinge und Kinder bis 1 Jahr und für alle anderen 800 IE über die Nahrung zur Vermeidung eines Vitamin D Mangels. Dies gilt aber nur zur Vermeidung der Rachitis bzw. der Knochenerweichung. Noch vor wenigen Jahren lag die Empfehlung bei nur 200 IE.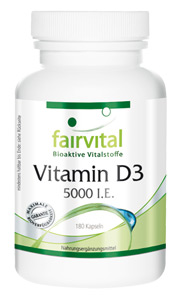
Diese Empfehlung gilt jedoch heute als überholt, da der Vitamin D3 Bedarf für optimale Gesundheit um einiges höher ist. Die jetzt von Vitamin D Experten empfohlene Tagesdosis zur Vorbeugung von Krankheiten liegt zwischen 1.000 bis 5.000 IE pro Tag für gesunde Erwachsene. Therapeutische Dosen liegen jedoch noch höher. Diese sollten aber nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen und mittels Bluttests überwacht werden.
Wieviel Vitamin D ist zu viel ?
Da Vitamin D fettlöslich ist, wird oft vor einer Überdosierung gewarnt. Da der Mensch bei direkter Sonnenbestrahlung 10.000 IE Vitamin D produziert, dürfte dies der physiologische Grenzwert sein. Bei allen bekannten Fällen von Vitamin D Überdosierung, bei denen die 25(OH)D-Konzentration und die Vitamin D-Dosis bekannt sind, wurden mehr als 40.000 IE pro Tag eingenommen. Man müsste diese Dosis jedoch über mehrere Monate täglich zu sich nehmen, damit es zu einer Vitamin D Intoxikation kommt. Einmalige Stoßtherapien von hohen Dosen, auch wenn diese mehrere 100.000 IE betragen, führen nicht zu einer Vitamin D Überdosierung.
Der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuss der Europäischen Kommission hat 2002 zur Sicherheit von Vitamin D Stellung genommen. Dabei wurde verlautbart, dass eine tägliche Dosis von 2.000 IE für Jugendliche, Erwachsene, Schwangere sowie stillende Mütter und 1.000 IE für Kinder in den ersten 10 Lebensjahren ohne Risiko von Nebenwirkungen auch ohne medizinische Aufsicht langfristig eingenommen werden kann. Von den meisten Experten wird für Erwachsene eine tägliche Zufuhr bis zu 5.000 IE Vitamin D über 6 Monate als sicher angesehen.
Kann man den Vitamin D Spiegel im Blut messen?
Man kann eine Form des Vitamin D, das 25(OH) Vitamin D im Blut bestimmen lassen. Bei der Bestimmung des Wertes muss jedoch bedacht werden, dass dieser nur etwas über die momentane Versorgung mit Vitamin D aussagt, aber man bekommt zumindest einen gewissen Anhaltspunkt.
Die Halbwertszeit für 25(OH) Vitamin D beträgt etwa 1-2 Monate. Verändert sich die Vitamin D Zufuhr nach oben oder nach unten, stellt sich ein neues Fließgleichgewicht mit einem stabilen Serumwert erst nach etwa 4 Monate ein.
Beispiel für einen verfügbaren Test des Vitamin D Spiegels:
Definition der Hypovitaminose D, basierend auf der 25(OH)D-Serumkonzentration:
VITAMIN D-STATUS nmol/l
anzustreben (präventiv) > 100 nmol/l
moderate Hypovitaminose 25 - 50 nmol/l
schwere Hypovitaminose < 25 nmol/l
Menschen in südlichen Ländern, die sich viel in der Sonne aufhalten, haben oft Werte von 100 nmol/l und zeigen keine Anzeichen einer Überdosierung. Dunkelhäutige Personen benötigen je nach Hauttyp eine 5-10mal längere Besonnung als Personen mit heller Haut, um die gleiche Menge an Vitamin D in der Haut zu produzieren.
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 27. November 2013



